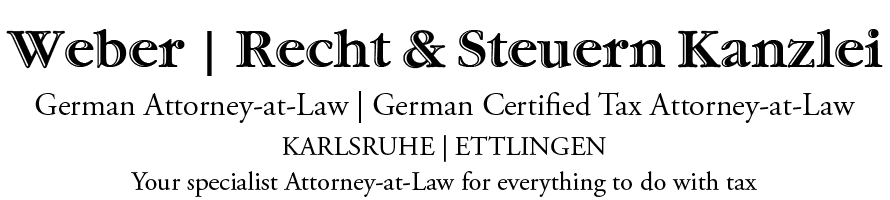Praxisrelevante Rechtsprechung zur Betriebsprüfung […] »
Die wichtigsten Gerichtsentscheidungen zur Betriebsprüfung im Jahr 2022.
Im Jahr 2022 ist eine Reihe von Gerichtsentscheidungen im Bereich der Betriebsprüfung ergangen.
Im nachfolgenden von mir verfassten Beitrag (NWB Steuer-und Wirtschaftsrecht 47/2023) sind in kompakter Form schwerpunktmäßig die Themenfelder herausgegriffen worden.
Diese Themenfelder weisen eine besondere Praxisrelevanz auf.
Dieser Beitrag ist nachfolgend in voller Länge und für bestimmte Zeit kostenlos abrufbar:
Praxisrelevante Rechtsprechung zur Außenprüfung
Schätzungen der Besteuerungsgrundlagen der Finanzbehörden infolge der abgeschlossenen Außenprüfungen und steuerrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Erlass der Prüfungsanordnungen sind oft der Streitgegenstand bei Finanzgerichtsverfahren.
Ansprechpartner für Steuerstrafrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstreitrecht (Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren), Seminare und Inhouse-Schulungen: Konstantin Weber, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Karlsruhe, Bruchsal, Rastatt, Ettlingen, Offenburg, Pforzheim, Baden-Baden, Speyer, Bühl, Gaggenau, Freudenstadt, Nagold, Horb am Neckar, Rheinstetten, Bretten, Waghäusel, Landau in der Pfalz, Germersheim, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen am Rhein, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen am Rhein, Mannheim, Schwetzingen, Heidelberg, Hockenheim, Wiesloch, Sinsheim, Mosbach, Neckargmünd, Bad Rappenau, Eppingen, Heilbronn, Ludwigsburg, Stuttgart
Kontakt: https://www.weberlaw.de/de/